Weisse Zwerge
Die Geburt eines Sterns dauert etwa 1 Million Jahre. Nach dem Durchleben einer unruhigen Anfangsphase kann ein Stern, wenn seine Masse nicht größer als 1,4 Sonnenmassen ist, für einen Zeitraum von rund 8 Milliarden Jahren als Hauptreihenstern ohne nennenswerte Störungen existieren. Danach ist der Wasserstoffvorrat im Kern aufgebraucht und es beginnt nun die Kernverschmelzung des im vorangehenden Leben erzeugten Heliums.
Zuvor wird sich der Kern aber verdichten, weil durch den nachlassenden Strahlungs- und Gasdruck nun die Gravitation überwiegt. Sie ist stets nach innen gerichtet und presst die Materie im Zentrum immer weiter zusammen, wodurch die Temperatur stetig ansteigt, bis schließlich das Helium fusioniert wird. Ist dieses verbraucht, beginnt das Kohlenstoffbrennen, der "Asche" aus der Heliumfusion. Nach und nach werden so immer schwerere Elemente ausgebrütet, bis der Kern bei sehr massiven Sternen zum Schluss nur noch aus Eisen besteht. Diese Prozesse sind abhängig von der Sternmasse, bei einem Zwergstern wie unserer Sonne ist das Ende erreicht, wenn der Kern nur noch aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht. Weitere Fusionen sind dann nicht mehr möglich, denn die Gravitation des Sterns reicht nicht mehr aus, um den Kern durch das Zusammenpressen entsprechend aufzuheizen.
Mit dem Ende des Wasserstoffbrennens im Kern (es wird nur noch Wasserstoff in einer den Kern umgebenden dünnen Schale fusioniert) wird auch weniger Energie freigesetzt. Das führt dazu, dass jetzt die Gravitation den Kern immer weiter kontrahieren lässt, wodurch dieser sich enorm aufheizt. Daraus resultiert letzten Endes ein Aufblähen des Sterns auf riesige Abmessungen, was wiederum eine Abkühlung der äußeren Hülle zur Folge hat. Der Stern wird zu einem Roten Riesen. Unserer Sonne ist dieses Schicksal natürlich auch beschieden und sie wird eines fernen Tages die inneren Planeten, vielleicht auch die Erde, verdampfen.
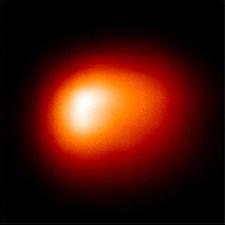
Mit freundlicher Genehmigung von NASA/RIT/J.Kastner et al.
Ist das Helium im Kern verbraucht, zieht sich der Stern etwas zusammen, bis das Kohlenstoffbrennen einsetzt. Danach dehnt er sich erneut aus, weil ja im Kern wieder mehr Energie freigesetzt wird. Über ein paar Jahrtausende wird der Stern so pulsieren und noch die im Kernbereich freigesetzte Energie abstrahlen. Können keine Kernreaktionen mehr ablaufen, wird der innere Stern durch die nun ungehindert einwirkende Gravitation kollabieren, was recht schnell erfolgt. Im Zentrum des Sterns wird keine Energie mehr freigesetzt, die bislang den notwendigen Strahlungs- und Gasdruck zur Erhaltung des Gleichgewichtes gegenüber der Gravitation lieferte.
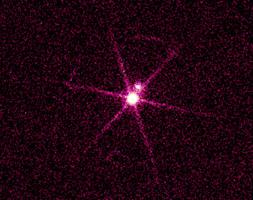
Mit freundlicher Genehmigung von NASA/SAO/CXC
Der Kernbereich stürzt nun innerhalb einer Sekunde in sich zusammen, bis seine Materie soweit zusammen gepresst ist, dass sie entartet. Der Kollaps kommt zu diesem Zeitpunkt schlagartig zum Stillstand, denn der Entartungsdruck der Elektronen lässt keine weitere Kompression des Kerns mehr zu. Bis jetzt hat die Hülle des Sterns noch gar nichts von den Vorgängen im Innern "bemerkt". Doch nun stürzt sie im freien Fall auf den Kern herab, aber dieser ist absolut hart und unnachgiebig.

Manchmal scheint es so, als ob Sterne nach ihrem "Tod" einen schöneren Anblick bieten als zu Lebzeiten. Hier ist das Ende eines sonnenähnlichen Sterns zu sehen (obwohl im Zentrum des Gebildes sich zwei Sterne umkreisen). Dieser Stern hat den so genannten Schmetterlingsnebel (ein Planetarischer Nebel) mit der Bezeichnung M2-9 gebildet, die abgestoßene Hülle bietet einen imposanten Anblick.
Mit freundlicher Genehmigung von B. Balick (U. Washington) et al., WFPC2, HST, NASA
Der Impuls der einstürzenden Gasmassen wird beim Aufprall auf den kollabierten Kern umgedreht und durch eine Art Überschallknall bläst der Stern dabei einen großen Teil seiner Hülle in den Raum. Dieser Masseverlust wird ergänzt durch den mit ansteigender Leuchtkraft stetig zunehmenden Sternenwind, einem stetigen Partikelstrom, der z.B. unser ganzes Planetensystem als Sonnenwind durchzieht. Zum Ende dieser Prozesse ist fast die gesamte Hülle abgeblasen, welche uns fortan als bereits erwähnter Planetarischer Nebel erfreut. Dabei hat der Stern einen großen Teil seiner ursprünglichen Masse in Form von Wasserstoff, Helium, Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und anderen Elementen an den interstellaren Raum zurückgegeben.
Der nun freigelegte Kern ist soweit verdichtet, dass ein Kubikzentimeter seiner Materie eine Tonne wiegt! Wollte man auf seiner Oberfläche spazieren gehen, müssten unsere Beine ein Gewicht von rund 600 Tonnen tragen! Durch die starke Gravitation sinken die restlichen schwereren Gase wie Helium nach unten auf die Oberfläche des Weißen Zwergs, während der leichtere Wasserstoff aufsteigt.
Das ist der Grund, warum viele Weiße Zwerge ein reines Wasserstoffspektrum zeigen, wir haben es mit so genannten DA- Sternen zu tun, (D kommt vom englischen dwarf = Zwerg). Andere, die keinen Wasserstoff mehr besitzen, weisen dagegen im Spektrum nur noch Helium auf (DB- Stern), weil dieses nun die obere Sternatmosphäre bildet.
Warum stürzt der übriggebliebene Kern nicht weiter in sich zusammen, da er doch keinen Strahlungsdruck und damit keine Wärme mehr erzeugen kann, sondern nur noch der Gasdruck der Gravitation entgegenwirkt? Nun, der Kern ist im Laufe des Sternenlebens ja immer weiter verdichtet worden, vor allem in den letzten Stadien. Dabei kann seine Innentemperatur bis auf 1 Milliarde (!) [K] ansteigen, was wiederum bedeutet, dass alle Atome ionisiert, das heißt von ihren Elektronen vollständig befreit sind. Wir haben es also mit einem so genannten Plasma zu tun, welches aus den "nackten" Atomkernen und den nun frei beweglichen Elektronen besteht.
In der Quantenphysik gilt, dass sich zwei Elektronen (oder andere Teilchen [Fermionen]) nicht beliebig nahe kommen können ( siehe hierzu Das Pauli- Verbot). Sie haben unter den Bedingungen im hochverdichteten und ultraheißen Sterninnern nur noch eine Ausweichmöglichkeit, die darin besteht, dass sie sich in ihrem Impuls unterscheiden. Alle anderen Quantenzahlen sind belegt, und so müssen sie sich immer schneller bewegen. Und zwar bis in den Bereich der Lichtgeschwindigkeit! Diese irrsinnig beschleunigten freien Elektronen üben den Druck aus, der eine weitere Kontraktion verhindert. Materie in diesem Zustand nennt man entartet; die Elektronen setzen nun der Gravitation ihren Entartungsdruck entgegen und der weitere Kollaps kommt zum Stillstand.
Allerdings ist auch hier wie allem in der Natur eine Grenze gesetzt: überschreitet die Masse des Restkerns etwa das 1,4- fache der Sonnenmasse - die so genannte Chandrasekhar- Grenze - kann auch der Druck der entarteten Elektronen einem noch weitergehenden Kollaps nicht mehr standhalten und je nach Restmasse wird sich ein Neutronenstern oder gar ein Schwarzes Loch bilden.
Der Reststern, nun zu einem Weißen Zwerg in Erdgröße mit einer Oberflächentemperatur von bis zu 200 000 [K] geworden, strahlt fortan über einen Zeitraum von mehreren Milliarden Jahren seine gesamte ihm noch innewohnende Energie ab (wohlgemerkt: Wärmeenergie, keine Fusionen mehr!), bis er völlig ausgekühlt ist. Er wird dann für alle Zukunft als Schwarzer Zwerg durch den Kosmos irren. Die Abkühlphase dauert jedoch sehr lange - seit Bestehen unserer Galaxis ist noch kein einziger Weißer Zwerg unter 4000 [K] abgekühlt!

Mit freundlicher Genehmigung von H. Bond (STScI), R. Ciardullo (PSU), WFPC2, HST, NASA
Eine riesige Anzahl dieser Sterne bevölkert unsere Galaxis, und auch die Sonne wird eines Tages zu solch einem Schlackeklumpen. Sonderbar ist, dass dieser entartete Gasball bei Erreichen einer Temperatur von 4000 [K] beginnt zu kristallisieren. Und so seltsam es klingen mag, die Entartung verschwindet nicht, auch bei noch so starker Abkühlung. Sie könnte nur durch eine Temperaturerhöhung zurück genommen werden, aber das bleibt dem Reststern für alle Zeiten vorenthalten. Ist der Weiße Zwerg Bestandteil eines Doppelsternsystems, so kann zwischen beiden Partnern ein heftiger Materieaustausch stattfinden, was ein noch bedeutend katastrophaleres Ende des Sterns zur Folge hätte. Der kleine Stern kann dann nämlich durch Akkretion von Materie einer sehr bewegten Zukunft entgegen sehen (siehe hierzu das nächste Kapitel Novae).