Planetarische Nebel
Der erste, der diese Art Gasnebel entdeckte, war William Herschel, als er vor rund 200 Jahren den Himmel durchmusterte. Er nannte sie Planetarische Nebel, weil sie ihn an das Aussehen einer Planetenscheibe im Teleskop erinnerten. Doch schon er selbst fand heraus, dass meist im Zentrum eines solchen Nebels ein Stern zu finden war.
Später erkannte man dann (1864, William Huggins), dass diese Objekte aus recht dünnem Gas bestehen. Bei spektroskopischen Untersuchungen fanden sich Emissionslinien von Wasserstoff, doch auch bis dahin unbekannte (sogenannte verbotene) Linien, welche man einem chemischen Element namens Nebulium zuordnete. Aber diese Linien in den Spektren (siehe hierzu auch Spektralklassen) waren nicht dem neuen (in Wirklichkeit nicht existierenden!) Element zuzuordnen, sondern durch einen physikalischen Vorgang erklärbar.

Mit freundlicher Genehmigung des Anglo Australian Observatory
Durch die energiereiche UV- Strahlung des Zentralsterns werden Elektronen des Wasserstoffs so angeregt, dass sie den Atomkern, das Proton, verlassen können. Damit befinden sich in einem Planetarischen Nebel viele freie, ionisierte Elektronen und Protonen. Irgendwann kann ein solches Proton aber wieder ein Elektron einfangen ("Rekombination"), welches sich aber zunächst auf einem hohen Energieniveau (d.h. in relativ weiter Entfernung vom Atomkern) befindet. Fällt es dann zurück in den Grundzustand (ein niedriges Energieniveau, auch Orbitale oder Aufenthaltwahrscheinlichkeit genannt) setzt es Energie frei (und zwar in Form von Photonen) und die verbotenen Linien werden erzeugt.
Auch höhere Elemente wie Helium, Sauerstoff und Stickstoff können an diesem Prozess teilhaben. Nach der Rekombination des Atoms kann es wieder ein energiereiches, stellares UV- Photon absorbieren und die Ionisation wiederholt sich. Das Besondere an den Planetarischen Nebeln ist, dass aufgrund der geringen Gasdichte jedes UV- Photon eine Ionisation auslöst, und damit ist die Zahl der beobachtbaren Rekombinationsphotonen proportional der UV- Leuchtkraft des Zentralsterns.
Weil nun die visuelle Helligkeit des Sterns proportional zur visuellen Leuchtkraft ist, kann man aus dem Verhältnis der Helligkeiten des Sterns und des Nebels auf die Temperatur des Sterns schließen. Daher wissen wir, dass die Zentralsterne Planetarischer Nebel so ziemlich die heißesten Sterne sind, denn man findet Oberflächentemperaturen von 30 000 bis 200 000 [K]. Diese Sterne sind Weiße Zwerge.
Planetarische Nebel zählen mit zu den beeindruckendsten Objekten am Himmel mit einer Fülle verschiedenster Formen. Das Spektrum geht dabei von einfachen, kugelförmigen Blasen über Doppel- und Dreifachhüllen bis hin zu irregulären Erscheinungsbildern. Wie aber entstehen nun diese leuchtenden Nebel?

Mit freundlicher Genehmigung von H. Bond (STScI) and NASA
Bedingung für die Bildung ist zunächst ein Stern im Endstadium seiner Lebensphase, wenn er das Riesenstadium erreicht hat. Bis dahin umgibt er sich bereits durch ständigen Masseverlust (u.a. durch Sternwind) mit einer expandierenden Gashülle. Diese Hülle ist innen viel dichter als außen, weil mit zunehmendem Alter die Leuchtkraft des Sterns und damit sein Masseverlust ansteigen.
Irgendwann hat der Riesenstern fast seine komplette Hülle abgestoßen, und es liegt ein heißer, noch aktiver Kern mit einer brennenden und stets dünner werdenden Wasserstoffschale frei. Von diesem Rest weht nun ein sehr schneller Wind, der die Gaswolke mehr und mehr zu einer Kugelschale zusammendrückt.
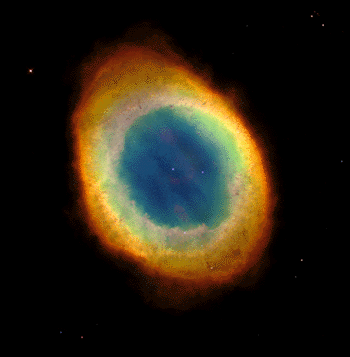
120 000 [K].
Mit freundlicher Genehmigung von STScI
Inzwischen steigt die Temperatur des Reststerns weiter an, und ab etwa 30 000 [K] wird so viel UV- Strahlung freigesetzt, dass die Gaswolke ihre "Beleuchtung" einschaltet, es ist ein Planetarischer Nebel entstanden. Diesen kann man nun für vielleicht 50 000 Jahre bewundern, doch dann wird er so verdünnt sein, dass er schließlich ganz erlischt. Übrig bleibt von dem ganzen Schauspiel nur ein sich ewig langsam abkühlender Weißer Zwerg, der letzte Zeuge eines vielleicht einstmals wundervollen Sonnensystems wie dem unseren.

Mit freundlicher Genehmigung von: Main image: X-ray: ESA/XMM-Newton; optical: NSF/NOAO/KPNO; inset: NASA/CXC/IAA-CSIC/M. Guerrero et al; optical: NASA/STScI

Mit freundlicher Genehmigung der ESO
Wenn Sie möchten, können Sie nun einen virtuellen Flug zum Nebel unternehmen:
©ESO/Digitized Sky Survey 2/N. Risinger (skysurvey.org)