Sternschnuppen
Höchstwahrscheinlich gehen nicht immer alle Wünsche in Erfüllung, die von Menschen beim Erspähen einer Sternschnuppe insgeheim gedacht werden. Wie sollten das auch die kleinen Trümmerstücke von 1 [mm] bis zu wenigen Zentimetern Durchmesser bewerkstelligen, wenn sie, von der Gravitation der Erde eingefangen, in einer Höhe von etwa 90 bis 110 [km] über dem Erdboden in der Atmosphäre verglühen?
Allerdings können wir viel von diesen Gesteinen extraterrestrischen Ursprungs lernen, wenn sie uns aus dem interplanetaren Raum erreichen. Sie sind Boten aus einer Zeit, als unser Sonnensystem entstand, vielmehr noch wurden sie vielleicht "produziert" von früheren Sterngenerationen, die heute längst nicht mehr existieren. Doch zunächst zur korrekten Benennung:
- Sternschnuppe
Leuchterscheinung in der Atmosphäre, die durch Verglühen kleiner Körper von 1 [mm] bis einige [cm] Durchmesser verursacht wird. Helligkeit max. -4m - Feuerkugel ("Bolide")
Sehr helle, seltene Sternschnuppe. Ein Körper von 10 [cm] Durchmesser erreicht Vollmondhelligkeit, längs der Bahn treten Lichtausbrüche oder Funkenschauer auf, sogar minutenlang nachleuchtende Schweife. Noch hellere Objekte werden beim Absturz von Donner begleitet. - Meteor
Allgemeine Bezeichnung für die durch einen in die Atmosphäre eindringenden Kleinkörper verursachte Leuchterscheinung - Meteorit
Ein Kleinkörper, der nicht vollständig in der Atmosphäre verglüht, sondern bis zum Erdboden gelangt. - Meteoroid
Ein die Sonne umlaufender Kleinkörper mit einem Durchmesser unter einem Kilometer. Manchmal auch als Meteorid bezeichnet, was aber sicherlich auf einen Schreibfehler zurückzuführen ist.
Die Begriffe Meteor, Meteoroid, Meteorit stammen vom griechischen meteoros ab, was soviel wie "in der Luft schwebend" oder allgemein eine "Erscheinung in der Luft" bedeutet. Hieraus leitet sich auch die Meteorologie ab, welche atmosphärische Phänomene wie Wind, Niederschläge in fester (Hagel, Schnee) und flüssiger (Regen) Form, Leuchterscheinungen (Polarlichter, Blitze) usw. beobachtet.
Es ist nur von seiner Masse abhängig, ob ein Meteoroid den "Ritt" durch die Atmosphäre übersteht und bis zum Erdboden gelangen kann. Sehen wir uns einmal an, was einem Körper auf seinem Weg zu uns geschieht.

Mit freundlicher Genehmigung von Vic & Jen Winter (ICSTARS Astronomy)
Wenn ein Meteoroid in die oberen Luftschichten eindringt, wird er mit den einzelnen Luftmolekülen kollidieren. Durch diesen Zusammenprall werden aus der Oberfläche des "Eindringlings" einzelne Atome herausgeschlagen, die nun ihrerseits die neu gewonnene kinetische Energie wiederum an Luftmoleküle abgeben. Der größte Teil dieser Energie (fast 99%) wird als Wärme freigesetzt, der geringe Rest regt Elektronen der Luftmoleküle an oder führt sogar zur Ionisation (Abtrennung einzelner Elektronen). Wenn die Elektronen wieder ihren Grundzustand einnehmen bzw. wenn die Ionen sich mit freien Elektronen rekombinieren werden Photonen freigesetzt und wir sehen das Leuchten des Meteors. Auf einen Nenner gebracht kann man also sagen, dass die Leuchtspur eines Meteors eine Spur glühenden Gases ist, das zum Teil aus dem Meteoroiden selbst herausgeschlagen wird und zum Teil aus hocherhitzter Luft besteht. Häufig wird aber sogar eine zweite Leuchtspur gesichtet! Jüngste Untersuchungen (Kelly et al.) zeigen, dass es sich dabei um eine Spur glühenden kosmischen Staubes handelt, die sogar Dutzende von Metern unterhalb der eigentlichen Spur liegen kann.
Durch die immer heftiger werdenden Zusammenstöße mit Luftmolekülen verliert ein Meteoroid ständig an Masse, je tiefer er gelangt. Zum Schluss verglühen die Körper mittlerer Größe vollständig (Sternschnuppen).
Am bekanntesten sind die August- Meteore - die Perseiden. Hier eine schöne Info- Grafik dazu, die von Universe2go.com zur Verfügung gestellt wird:
Sehr kleine Körper mit Durchmessern von weniger als etwa 0,1 [mm] sind entsprechend leicht, man bezeichnet sie als Mikrometeoroide. Ihr Weg durch die Atmosphäre fällt ihnen im wahrsten Sinne des Wortes damit auch viel leichter, denn sie werden so stark von der Atmosphäre abgebremst, dass sie praktisch unverändert und unversehrt herunter schweben. Sie erzeugen somit auch keine Leuchterscheinungen. Feuerkugeln haben wesentlich mehr Masse als Sternschnuppen oder Mikrometeoroide, sie dringen daher viel tiefer in die Atmosphäre ein. Hier, in Höhen von 10 [km] bis 50 [km], treffen sie auf deutlich dichtere Luftschichten, wodurch sie sich bis auf rund 3000 [K] erhitzen. Das lässt sie an der Oberfläche schmelzen, Explosionen können sogar zur Zertrümmerung des Körpers führen. Vor dem fallenden Meteoroiden bildet sich in der Atmosphäre eine Stoßfront aus, woraus eine hinter ihm liegende, erhitzte Zone verdichteter Gase entsteht. Die meisten Leuchterscheinungen bilden sich hier aus.
Nicht verdampfte Reste des Meteoroiden können nun im freien Fall als Meteorit zur Erde gelangen.
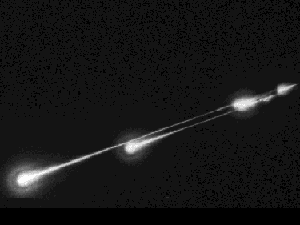
Im Januar 2004 konnten die Menschen im Rhein- Main- Gebiet in den frühen Morgenstunden eine ebensolche Beobachtung machen.
Fotografie: S. Eichmiller, Altoona, P.A.

Mit freundlicher Genehmigung von Pierre Thomas (LST), ENS Lyon
Am 15. Februar 2013 ging über Russland ein Meteorit nieder. Als er in die Atmosphäre eindrang, hatte er wohl eine Größe von etwa 15 Metern und eine Masse von 7000 Tonnen. Seine Geschwindigkeit betrug 72 000 [km/h]. In 20 [km] Höhe zerbarst er dann vollständig, der Niedergang lag etwa 1500 [km] von Russland entfernt. Durch die Druckwelle zersplitterten unzählige Fensterscheiben in der Stadt Tscheljabinsk, wodurch über 1200 Menschen verletzt wurden. Viele Videos dokumentieren den Niedergang, hier ist eines davon:
Weil Meteore nur unvoraussagbar auftreten, gestaltet sich ihre Beobachtung naturgemäß sehr schwierig. Insbesondere, wenn man aus den Leuchtspuren auf die Bahnen schließen will. Eine sinnvolle Möglichkeit bietet sich hier aber durch Langzeitaufnahmen bestimmter Himmelsregionen an. Man positioniert hierzu mindestens zwei lichtstarke Kameras in mehreren Kilometern Entfernung voneinander. So kommt man zu einem Stereobild des Himmelsausschnitts und kann die räumliche Lage evtl. fotografierter Meteore feststellen. Durch eine rotierende Scheibe vor dem Objektiv, welche eine Öffnung aufweist und so den Lichtweg periodisch unterbricht, erhält man Unterbrechungen in der Leuchtspur. Die Scheibengeschwindigkeit ist bekannt, und somit kann man eine Aussage über die Geschwindigkeit des fallenden Körpers machen.
Eine verwandte Methode bedient sich der Radioastronomie. Hier werden zwei Radioteleskope verwendet, die kurze Impulse aussenden. Diese werden durch freie Elektronen des ionisierten Gases, verursacht durch den fallenden Meteoroiden, reflektiert. Aus der Laufzeit und Form der reflektierten Pulse kann man auf die Lage der Bahn und die Geschwindigkeit schließen. Dieses Verfahren lässt sich natürlich auch am Tag einsetzen.
Die Bahnen der Meteoroiden können Ellipsenform zeigen, wenn sie die Sonne umlaufen, sie treten jedoch auch parabel- oder hyperbelförmig auf, wenn sie aus dem interstellaren Raum stammen. Der größte Teil dieser Körper kommt jedoch mit Sicherheit aus dem Sonnensystem.
Meteore können sporadisch erscheinen, also zu völlig unberechenbaren Zeitpunkten. Jeder kennt aber auch die Meteorströme (Meteorschwärme), die uns regelmäßig mit den faszinierenden Himmelserscheinungen versorgen. Die Bahnen der sporadischen Meteore sind demnach völlig wahllos am Himmel verteilt, wohingegen die Meteore eines Schwarms scheinbar alle von einem Punkt des Himmels ausgehen. Benannt wird ein Meteorstrom nach dem Ort am Himmel (der Radiant), aus dem die Meteore scheinbar entspringen. So gehen z.B. die Orioniden aus dem Sternbild Orion nieder. Liegt der Radiant in Richtung Sonne, haben wir es mit einem Tageslichtstrom zu tun. Diese Meteore lassen sich nicht optisch beobachten, wohl aber mit Radioteleskopen.

Nun wird man sich fragen, wieso denn überhaupt Meteore entweder vereinzelt oder gleich als ganzer Schwarm auftreten. Wer den Abschnitt über Kometen gelesen hat, wird bereits die Erklärung kennen:
Kommt ein Komet in relative Sonnennähe, verdampft (genauer: sublimiert) durch die Erwärmung sein Eis zu Gas, dabei werden feste Teilchen mitgerissen und bilden eine Teilchenwolke entlang der Bahn des Kometen aus. Kreuzt die Erde auf ihrer Bahn diese Meteoroidenwolke, erleben wir einen Meteorschauer. Wir wissen dies, weil die Bahnen einiger Kometen recht exakt mit denen der Meteoroidenschwärme übereinstimmen. Durch den Sonnenwind, durch Zusammenstöße innerhalb der Wolke und durch die gravitationsbedingte Beeinflussung der Planeten löst sich nach und nach die Teilchenwolke auf. Der scheinbare Ursprungsort der Meteore am Himmel wird immer größer und schließlich sehen wir sie nur noch sporadisch.
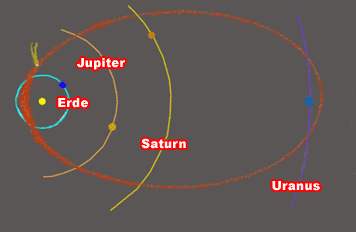
Ist die Bahn eines Meteoroidenschwarms nur wenig gegen die Ebene der Erdbahn (Ekliptik) geneigt, können sich sogar zwei Schnittpunkte ergeben, so dass wir von einem Strom zweimal jährlich einen Meteorschauer beobachten können (z.B. Orioniden, Aquariniden). Einer der Schauer kann allerdings auch als Tageslichtstrom auftreten. Ähnlich wie in dieser Skizze sind die Verhältnisse bei den im November erscheinenden Leoniden, nur liegt die Bahn des verursachenden Kometen 1866 I weiter außerhalb der Erdbahn, so dass wir durch nur eine Schnittstelle lediglich einen Schauer zu sehen bekommen.
Jeden Tag könnten wir theoretisch etwa 100 Millionen (!) Meteore auf der gesamten Erde sehen. Hierdurch steigt auch die Masse unseres Planeten an, man geht von jährlich rund 50 000 Tonnen aus. Wenn wir uns allerdings in einer klaren Nacht das Firmament ansehen, können wir meist nicht mehr als vielleicht 8 Sternschnuppen je Stunde erblicken. Selbst dann nicht, wenn wir den Höhepunkt eines Meteorschauers erleben, denn man kann nicht gleichzeitig den gesamten Himmel beobachten. Könnten wir das, wären etwa 25 bis 40 Ereignisse in der Stunde zu sehen, in "ergiebigen" Jahren bei den großen Meteorströmen sogar bis zu 1000.
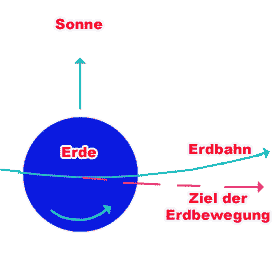
Meteore lassen sich nur schwerlich untersuchen, da man ihrer nicht so leicht habhaft wird. Einige zur Erde schwebende Körnchen wurden schon mit hochfliegenden Flugzeugen eingefangen, wobei deren Herkunft natürlich ungewiss war.

Mit freundlicher Genehmigung von NASA/JPL
Es gibt aber auch einen bequemeren Weg, um an Proben des kosmischen Materials zu gelangen. Man wartet einfach, bis ein "Stein" vom Himmel fällt, oder man weiß, wo man danach suchen muss. Von diesen Meteoriten handelt der nächste Abschnitt.
