Hinweis auf die DSGVO: Auf unserer Seite werden keine Dritt-Anbieter-Cookies verwendet und nur Daten erfasst, welche für das Minimum an Board-Funktionalität notwendig sind.
Bevor Sie sich registrieren oder das Board verwenden, lesen Sie bitte zusätzlich die DSGVO-Erklärung, welche in der Navigationsleiste verlinkt ist.
Kurzfassung der unserer Meinung nach wichtigsten DSGVO-Punkte:
Es kann vorkommen, dass Benutzer eigenverantwortlich Videos oder sonstige Medien in ihren Beiträgen verlinken, welche beim Aufruf der Forenseite als Teil der Seite samt zugehörigem Material mitgeladen werden. Sollten Sie dies nicht wünschen, verwenden Sie beim Benutzen des Forums einen Blocker wie z.B. uMatrix, welcher das Laden von Inhaltsblöcken von Fremd-URLs effektiv unterbinden kann.
Wir blenden keine Werbung ein und schränken die Inhalte in keinster Weise bei Benutzung von Addblockern ein. Dadurch ist die Grundfunktionalität des Forums auch bei vollständigem Blockieren von Drittanbieter-Inhalten stets gegeben.
Cookies werden unsererseits nur verwendet um das Einloggen des Benutzers für die Dauer der Forenbenutzung zu speichern. Es steht dem Benutzer frei die Option 'Angemeldet bleiben' zu verwenden, damit der Cookie dauerhaft gespeichert bleibt und beim nächsten Besuch kein erneutes Einloggen mehr notwendig ist.
EMail-Adressen werden für Kontakt bei wichtigen Mitteilungen und zur Widerherstellung des Passwortes verwendet. Die verwendeten IPs können von uns ohne externe Hilfsmittel mit keiner realen Person in Verbindung gebracht werden und werden nach spätestens 7 Tagen gelöscht. Diese IPs werden höchstens verwendet um Neuanmeldungen unerwünschter oder gesperrter Nutzer zu identfizieren und zu unterbinden. Wir behalten uns daher vor bei Verdacht, die Frist für die IP-Löschung auf maximal 14 Tage zu verlängern.
Unsere Webseite läuft auf einem virtuellen Linux-Server, welcher von einem externen Anbieter gehostet wird. Etwaige Verstöße der DSGVO-Auflagen seitens dieses deutschen Hosters können wir nicht feststellen und somit auch nicht verfolgen.
Wir halten Backups unserer Datenbanken, welche in regelmäßigen Abständen als Schutz vor Katastrophen, Hackerangriffen und sonstigen Ausfällen erstellt werden. Sollte ein Nutzer die Löschung seiner Daten wünschen, betrachten wir es als Unzumutbar die Backups auch von den Daten zu befreien, da es sich hierbei um eine mehrtägiges Unterfangen handelt - dies ist für eine Einzelperson beim Betrieb eines privaten Forums nicht zumutbar möglich ohne das Backup komplett zu löschen.
Sollten Sie etwas gegen die dauerhafte anonyme Speicherung ihrer EMail-Adresse, ihres Pseudonyms und ihrer Beiträge in einem Backup haben, sehen Sie von der Registrierung in diesem Forum ab. Für Mitglieder, welche vor dem 25.05.2018 registriert waren steht jedoch das Recht im Raum, eine Löschung der Datenbank-Backups zu beantragen.
Wenn dies Ihr erster Besuch hier ist, lesen Sie bitte zunächst die FAQs sowie die wesentlichen Regeln zur Benutzung des Forums.
Um an den Diskussionen teilnehmen zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren.
Bevor Sie sich registrieren oder das Board verwenden, lesen Sie bitte zusätzlich die DSGVO-Erklärung, welche in der Navigationsleiste verlinkt ist.
Kurzfassung der unserer Meinung nach wichtigsten DSGVO-Punkte:
Es kann vorkommen, dass Benutzer eigenverantwortlich Videos oder sonstige Medien in ihren Beiträgen verlinken, welche beim Aufruf der Forenseite als Teil der Seite samt zugehörigem Material mitgeladen werden. Sollten Sie dies nicht wünschen, verwenden Sie beim Benutzen des Forums einen Blocker wie z.B. uMatrix, welcher das Laden von Inhaltsblöcken von Fremd-URLs effektiv unterbinden kann.
Wir blenden keine Werbung ein und schränken die Inhalte in keinster Weise bei Benutzung von Addblockern ein. Dadurch ist die Grundfunktionalität des Forums auch bei vollständigem Blockieren von Drittanbieter-Inhalten stets gegeben.
Cookies werden unsererseits nur verwendet um das Einloggen des Benutzers für die Dauer der Forenbenutzung zu speichern. Es steht dem Benutzer frei die Option 'Angemeldet bleiben' zu verwenden, damit der Cookie dauerhaft gespeichert bleibt und beim nächsten Besuch kein erneutes Einloggen mehr notwendig ist.
EMail-Adressen werden für Kontakt bei wichtigen Mitteilungen und zur Widerherstellung des Passwortes verwendet. Die verwendeten IPs können von uns ohne externe Hilfsmittel mit keiner realen Person in Verbindung gebracht werden und werden nach spätestens 7 Tagen gelöscht. Diese IPs werden höchstens verwendet um Neuanmeldungen unerwünschter oder gesperrter Nutzer zu identfizieren und zu unterbinden. Wir behalten uns daher vor bei Verdacht, die Frist für die IP-Löschung auf maximal 14 Tage zu verlängern.
Unsere Webseite läuft auf einem virtuellen Linux-Server, welcher von einem externen Anbieter gehostet wird. Etwaige Verstöße der DSGVO-Auflagen seitens dieses deutschen Hosters können wir nicht feststellen und somit auch nicht verfolgen.
Wir halten Backups unserer Datenbanken, welche in regelmäßigen Abständen als Schutz vor Katastrophen, Hackerangriffen und sonstigen Ausfällen erstellt werden. Sollte ein Nutzer die Löschung seiner Daten wünschen, betrachten wir es als Unzumutbar die Backups auch von den Daten zu befreien, da es sich hierbei um eine mehrtägiges Unterfangen handelt - dies ist für eine Einzelperson beim Betrieb eines privaten Forums nicht zumutbar möglich ohne das Backup komplett zu löschen.
Sollten Sie etwas gegen die dauerhafte anonyme Speicherung ihrer EMail-Adresse, ihres Pseudonyms und ihrer Beiträge in einem Backup haben, sehen Sie von der Registrierung in diesem Forum ab. Für Mitglieder, welche vor dem 25.05.2018 registriert waren steht jedoch das Recht im Raum, eine Löschung der Datenbank-Backups zu beantragen.
Wenn dies Ihr erster Besuch hier ist, lesen Sie bitte zunächst die FAQs sowie die wesentlichen Regeln zur Benutzung des Forums.
Um an den Diskussionen teilnehmen zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren.
Entstehung des Lebens auf der Erde
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Interstellarer Staub könnte bereits außerirdische Lebensformen zur Erde gebracht haben.
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.d ... n20171121/
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.d ... n20171121/
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
1 zu 1 sicher nicht, es könnte aber Beginne, Graustufen davon geben.ATGC hat geschrieben: ↑21. Nov 2017, 11:51Wenn es sich um einen zyklischen Prozess handelt, ja, aber damit Peptidketten funktional rückkoppeln können, müssen sie spezifisch geformt sein - und damit einen Kernbestand an spezifischen Aminosäuren in den Positionen aufweisen, wo es auf bestimmte Faltungsmuster ankommt. Das Problem entsteht in der Reproduktion von Peptidketten, die ähnlich gefaltet sind wie ihre inzwischen zerfallenen Vorläufer. Ohne eine hinreichend genaue Reproduktion kollabieren die Reaktionszyklen bzw. es konstituieren sich andere, die mit den Vorläuferzyklen nichts zu tun haben. Oszillation zeichnet sich aber durch eine Rückkopplungsschleife aus, so dass sich ein bestimmter Ausgangszustand nach einiger Zeit wieder herstellt. Ich denke nicht, dass man das 1 zu 1 auf den unspezifischen Aufbau und Zerfall von Zufallspolymeren wie Polypeptiden übertragen kann.
Das hört sich für mich nach einer Weiterentwicklung des Ursuppenansatzes aus. Interessant und plausibel, na gut, dann infiltrierte die Ursuppe wahrscheinlich eben poröses Gestein.ATGC hat geschrieben: ↑21. Nov 2017, 11:51Na ja, von der Vorstellung, die ersten Organismen hätten sich in einer Ursuppe gebildet, sollten wir uns verabschieden. Plausibler sind Stoffwechselsysteme auf mineralischen Oberflächen, bei denen Membranstrukturen für eine Teilkompartimentierung gesorgt haben, so dass sich separate Bereiche entwickeln konnten, ohne das alles ins chemische Gleichgewicht kollabierte. Die "Ursuppe" war nützlich für den Stoffaustausch zwischen den Teilsystemen, aber die entscheidenden Prozesse liefen eher in der Gel-Phase ab - vielleicht analog zu den Oparinschen Koazervaten - die sich auf den mineralischen Unterlagen erstreckte. Dort war einfach mehr Stabilität gegeben.
Das mag alles sein. Worum es mir bei dieser "Standardfolklore" geht, ist dass diese Perpektive strikt auf ein von "unten nach oben" gerichtet scheint. Ich denke darüber nach, ob und wie sich das durch einen Blick von "oben nach unten" ergänzen lässt.ATGC hat geschrieben: ↑21. Nov 2017, 11:51Die Passformen waren zuerst über die Struktur des mineralischen Untergrundes vorhanden - einschließlich der katalytisch wirksamen Metall-Ionen. Peptide, die sich später zu Proteinen entwickelten, imitierten diesen Untergrund zum einen durch die Form (aktive Zentren der Proteine als charakteristische Einstülpungen und Ausbuchtungen auf der Moleküloberfläche) und zum anderen durch die mineralischen Komponenten, die als prosthetische Gruppe die Funktionalität des Proteins gewährleisten (siehe dazu z.B. die Fe-S-Cluster in den Ferredoxinen). Das heißt, dass von Anfang an das Schlüssel-Schloss-Prinzip für enzymatische Aktivitäten gültig war. Es dauerte nur seine Zeit, bis geeignete Proteine heranwachsen konnten, die dieses Prinzip in eine transportable und reproduzierbare Form brachten. Und dann natürlich die Kopplung an die RNA-Chemie, die zur Entstehung der Translation führte ...wenn sie zuerst noch nicht ganz direkt nach dem "Schlüssel-Schloss-Prinzip" miteinander interagieren
Klar ist, dass wir für Leben mindestens drei Zutaten brauchen: Einen Replikationsträger (z.B. RNA), "Replikationsmaschinen" (z.B. Proteine) und eine Teilabgrenzung zur Umwelt (z.B. Membran).
Das ist der Blick von unten nach oben.
Von oben nach unten gesehen, brauchen wir ein dynamisches System, dass sich von der Umwelt teilabgrenzt, globale Bedingungen schafft, die auf seine Elemente rückwirken und in der Lage ist seine Komplexität zu steigern, also zur Evolution fähig ist.
Um das tun zu können muss es strukturbildende Attraktoren herausbilden. Solche Attraktoren wirken auf das Verhalten seiner Elemente ähnlich wie Naturgesetze ein.
Ich möchte die Idee in dem Zitat etwas anders ausdrücken:
Die Systeme produzieren die Elemente aus denen sie bestehen werden, durch die Elemente aus denen sie bestanden.
Dazu ist ganz am Anfang noch keine vollständige Reproduktion notwendig, es reicht, wenn sich im System geringste "Vorlieben" einstellen, die dann mit der Zeit in machen Fällen dominat werden können, ähnlich wie teilweise bei der biologischen Evolution. Bifurkationen...
Einfaches Beispiel, wahrscheinlich nicht ganz stimmig, da aus dem Stehgreif, aber hoffentlich inspirierend:
Nehmen wir an, wir hätten ein teilisoliertes System, in dem kurze Peptidketten drin sind und kurze RNA-Ketten (und viele weitere Zutaten).
Dann ist die Frage: Können und werden die auf dieser Stufe aufeinander einwirken und wie?
Als Idee: Nun könnte es sein, dass manche Peptidketten zufällig eine Struktur aufweisen, die bei passenden RNA-Ketten bei Stößen ein klein wenig bevorzugt ein bestimmtes Atom anregen, was dazu führt, dass, wenn sich die RNA-Kette zufällig durch den Anbau eines weiteren Nucleotids verlängert, dass durch die Anregung des bestimmten Atoms bestimmte Nucleotide ein klein wenig bevorzugter angebaut werden als andere.
Diese bestimmten verlängerten RNA-Ketten könnten durch Stöße wiederum zufällig so auf Aminosäureketten einwirken, dass sie wiederum bevorzugt ein bestimmtes Atom im Peptid so anregen, dass umgekehrt gerade die Bidung der Peptide, die unser bestimmtes RNA-Molekül etwas mehr zur Bildung anregen, sich auch bevorzugt bilden.
Schon hätten wir den Anfang eines Kreislaufs, wo unter bestimmten Systembedingungen sich mit der Zeit bestimmte Aminosäureketten und bestimmte RNA-Ketten anreichern, die in einer bestimmten Weise zueinander "passen", ohne sich schon wirklich exakt reproduzieren zu können.
Und so ein Anfang könnte sich mit der Zeit immer weiter ausdifferenzieren, bis man am Ende tatsächlich Leben hat.
In Wirklichkeit wird alles natürlich viel komplizierter sein, aber ich hoffe ich kann den Gedanken damit klarmachen.
Jep, jedoch auf längere Sicht: indem es evolviert!
Man sollte den Blick daher nicht nur auf die Elemente lenken und sich das System allein als "aus Elementen zusammengebaut" denken.
Man sollte den Blick zusätzlich auch darauf lenken, wie das System als Gesamtheit auf seine Teile einwirkt.
The whole is to some degree constrained by the parts (upward causation), but at the same time the parts are to some degree constrained by the whole (downward causation).
Wenn ich sterbe, dann werden nach und nach auch alle meine Körperzellen sterben; zuletzt -soweit ich weiß- die Zellen, die den Horn meiner Nägel bilden.
Die Ursache für das Sterben dieser Zellen ist der Tod des Gesamtsystems "Mensch", also steckt da eine Abwärtsverursachung drin.
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo Dgoe,
MfG
Lothar W.
Das Verständnis des ganz Kleinen hilft bei der Erklärung, wie Naturgesetze und Konstanten entstehen. Neben den Erhaltungssätzen kann man damit auch an die Frage herangehen, wie Strukturbildung gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik möglich ist? Wenn das bei der Elementarteilchenbildung funktioniert, sollte es auch bei den Molekülen,... funktionieren. Es ist dann eine zwangsweise Entwicklung, wie sie in dem Film, welchen Du verlinkt hast, dargestellt wird.Dgoe hat geschrieben: ↑22. Nov 2017, 00:42"das ganz Kleine zu verstehen" hilft hier wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Nimm ein Gas mit Temperatur und Druck. Und daraus ein Atom, was weder Temperatur noch Druck verspürt. Das Atom kannst Du drehen und wenden, wie Du willst, auf den übergeordneten Zusammenhang kommst Du so sicher nie, von diesem Einzel"stück" ausgehend.
MfG
Lothar W.
https://struktron.de/
Szenario der Entwicklung des Universums
Szenario der Entwicklung des Universums
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo


Die ganze Zeit gibt es noch einen kompletten Wikipedia-Artikel haargenau zum Thema, randvoll gefüllt mit Links und Referenzen, gerade entdeckt:
Chemische_Evolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Evolution
(wer findet, der findet)
Edit:
Und nochmal doppelt so umfangreich (wie so oft), der Gleiche auf Englisch:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis

Die ganze Zeit gibt es noch einen kompletten Wikipedia-Artikel haargenau zum Thema, randvoll gefüllt mit Links und Referenzen, gerade entdeckt:
Chemische_Evolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Evolution
(wer findet, der findet)
Edit:
Und nochmal doppelt so umfangreich (wie so oft), der Gleiche auf Englisch:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo ATGC,
interessante Rechnung. Beihnah hätte ich den Beitrag übersehen, das war oben zufällig zur ungefähr gleichen Zeit.
Apropos zufällig, es könnte zufällig auch nur 1 Minute gedauert haben, bis die gangbare Kombination gefunden wurde, richtig?
Gruß,
Dgoe
interessante Rechnung. Beihnah hätte ich den Beitrag übersehen, das war oben zufällig zur ungefähr gleichen Zeit.
Apropos zufällig, es könnte zufällig auch nur 1 Minute gedauert haben, bis die gangbare Kombination gefunden wurde, richtig?
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Ja, ich verstehe. Weil die aus der Bewegung heraus langsam entstehenden Strukturen so noch nicht in Materie "gemeißelt" sind.ATGC hat geschrieben: ↑22. Nov 2017, 10:06Das läuft über chemische Gleichgewichte entlang von Dichte- und Konzentrationsgradienten sowie Temperaturgradienten. Da sich der finale chemische Gleichgewichtszustand nicht einstellt, bleibt alles im Fluss, so dass sich weitere Strukturen entfalten können (dissipative Strukturen). Von der Art und Weise des Durchflusses hängt es ab, wie stark und wie umfassend das Gesamtsystem fluktuiert, so dass sich andere oder neue Strukturen herausbilden bzw. labile Strukturen kollabieren und durch andere, robustere ersetzt oder verdrängt werden. Eine Entwicklungsfähigkeit ist hier auf chemischer Ebene bereits gegeben, die sich dann in Gestalt von dissipativen Strukturen manifestiert.Um das tun zu können muss es strukturbildende Attraktoren herausbilden.
Allerdings ist diese Entwicklungsfähigkeit nicht gleichbedeutend mit evolvierbar, weil hier noch nichts tradiert wird. Tradierbarkeit geht mit der Reproduktion von Sequenzen einher, die wiederum eines Apparates bedarf, der über die Sequenzen mit tradiert wird. Kurz: Evolution erfordert einen Genotyp, der einen Phänotyp repräsentiert, indem das Stoffwechselsystem sich der Sequenzen des Genotyps bedient, um den Phänotyp im Kontext zur Umgebung hervorzubringen und im Bestand zu erhalten. So etwas ist auf der präbiotischen Entwicklungsstufe aber noch nicht gegeben.
Dennoch.... wir haben auch vorher schon prozesshafte Strukturbeziehungen die sich manchmal langsam hoch und runterentwickeln, kontinuierlich fluktuieren, manchmal Sprünge machen.
Danke! Ja, solche Dinge stelle ich mir vor.
Das liegt in der Natur komplexer Systeme: sie sind in großenTeilen unvorhersehbar. Man kann allerdings Wahrscheinlichkeitsaussagen generieren und Plausibilitäten angeben.
Interessant. In deiner Rechnung gehst du soweit ich das sehe nur hauptsächlich vom Zufall als Motor aus und musst viele Unabwägbarkeiten irgendwie einpflegen und auch stark vereinfachen. Ja, du kommst so schon zu dem Schluss, dass ein gangbarer Weg allein so schon nicht unmöglich sein könnte, vielleicht...
Es braucht jedoch extrem wenig Zutaten um chaotische Systeme zu erhalten, das finden wir schon z.T. bei ganz, ganz einfachen Systemen.
Und um einfache komplexe Systeme zu erhalten, die sich weiterentwickeln können, braucht es auch überraschend wenig, eigentlich erschreckend wenig.
D.h. ich vermute an der Stelle einen Beschleuniger, eigentlich bin ich sicher, dass das eine Rolle gespielt hat.
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Das heißt m. E. nur, dass unsere Wahrscheinlichkeitsaussagen im Moment noch recht ungenau und z.T. widersprüchlich sind, weil wir noch zu wenig wissen und unsere Herangehensweise noch nicht weit genug entwickelt ist.ATGC hat geschrieben: ↑24. Nov 2017, 09:25Leider kann man das in diesem Falle nicht. Chemische Reaktionsnetzwerke müssen nicht in evolvierbare Systeme münden, sondern können sich ebensogut langfristig totlaufen. Wir können da nichts vorab numerisch abschätzen, um eine Wahrscheinlichkeit anzugeben, wie oft pro Systemansatz eine Translation rauskommt, deren Produkte systemstabilisierend rückkoppeln. Im Gegenteil: Wir haben eine Fülle von Hypothesen, die jede für sich durchaus plausibel ist, aber wir haben kein Kriterium zur Hand, um zu entscheiden, welche der Hypothesen die zutreffende ist. Weiterhin haben wir keinen Ansatz, der sich als Wahrscheinlichkeit für das Entstehen von Leben interpretieren ließe: Jede Hypothese befindet sich in einer Grauzone, wo sich keine Wahrscheinlichkeit des Eintreffens angeben ließe. In Bezug auf diese Unbestimmtheit sind somit alle Hypothesen gleichermaßen wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich. Aber das bringt uns erkenntnismäßig natürlich nicht weiter.Man kann allerdings Wahrscheinlichkeitsaussagen generieren und Plausibilitäten angeben.
Wahrscheinlichkeitsaussagen, Abschätzungen und Vermutungen treffen wir aber trotzdem schon, das ist normal, das tust du ja auch.
Im Diskurs werden dann die Varianten/Wege ausgewählt, die für die Mehrheit der Wissenschaftler am Erfolgversprechendsten ausschauen und die werden dann vermehrt weiter verfolgt/untersucht. Das ist normal.
Ja. Deshalb sind solche Betrachtungen interessant.ATGC hat geschrieben: ↑24. Nov 2017, 09:25Mir ging es in erster Linie darum, herauszufinden, ob das Sequenzenspektrum hinsichtlich der verfügbaren Mengen, Zeiten und Orte auf der Erde irgendwelchen Einschränkungen unterlegen sein muss oder nicht. Und wie sich zeigt, gab es von den allgemeinen Rahmenbedingungen her keine Einschränkungen. Die Sequenzen waren also prinzipiell frei kombinierbar und die Kapazität der Erde war hinreichend, dass frei kombiniert werden konnte.nur hauptsächlich vom Zufall als Motor aus
Quantität schlägt irgendwann in Qualität um.ATGC hat geschrieben: ↑24. Nov 2017, 09:25Das heutige System ist zwar komplexer als das ursprüngliche, aber die Grundproblematik dürfte erkennbar sein: Es geht um eine andere Qualität und nicht um eine sukzessive Vermehrung von bereits bestehenden Qualitätsniveaus, indem sich z.B. nur das Reaktionsspektrum erweitert, die Moleküle schrittweise länger und komplexer werden usw. Leben überschreitet den Rahmen der zugrundeliegenden Chemie und bewirkt eine neue Ebene von Wechselwirkungen, die sich nicht mehr hinreichend durch Chemie beschreiben lässt. Nötig ist also ein Qualitätssprung, und dieser Qualitätssprung lässt sich nicht aus der Vermehrung der Quantität der chemischen Reaktionen ableiten. Hier entsteht etwas Neues.
Ja, hier entsteht etwas Neues.
Mein Punkt ist, dass man sich dabei nicht nur auf die qualitativen Unterschiede konzentrieren sollte und die allein streng getrennt untersuchen sollte, sondern auch das Gemeinsame der beiden Qualitäten suchen und untersuchen sollte.
Und solche Gemeinsamkeiten gibt es.
Indem ich den Blick auf das Gemeinsame aus beiden Welten lege.ATGC hat geschrieben: ↑24. Nov 2017, 09:25ich vermute an der Stelle einen Beschleuniger, eigentlich bin ich sicher, dass das eine Rolle gespielt hat.
Wie und an welcher Stelle willst Du da etwas beschleunigen? Entweder die Dinge finden sich glücklicherweise passend zusammen oder sie finden sich nicht zusammen.
Das Zufallselement ist sicher immer wichtig, jedoch können Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse durch den prozesshaften Gesamtzustand von Systemen beeinflusst werden - gleich auf welcher Ebene.
Der Weg zum Leben kann m. E. unmöglich allein aus dem reinen Zufall heraus erklärt werden.
Hier stellt sich die Frage unter welchen Systembedingungen, bei welchen komplexen Prozessen sich die Dinge mit welcher Wahrscheinlichkeit passend zusammenfinden?
Wenn ein System diese Wahrscheinlichkeit erhöht, dann wirkt es als Beschleuniger, gleich auf welcher Ebene (Physik, Chemie, Bilologie, etc.).
Komplexe Systeme fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht haben die Tendenz ihre Komplexität zu erhöhen.
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
@ATGC:
Danke für die Links, hab den Rauchfuß bestellt, allerdings als Paperpack für 22,99 von 2012, statt Hardcover für 27,- von 2005.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/364232403 ... +rauchfuss
Über http://b-ok.org/s/?q=Horst+Rauchfuss&ye ... nsion=&t=0
findet sich dazu auch etwas, auf Englisch. Überhaupt viele Dinge zu finden dort (Nachfolger von bookzz, thanks to @Struktron for the hint elsewhere)
So far,
Gruß,
Dgoe
Danke für die Links, hab den Rauchfuß bestellt, allerdings als Paperpack für 22,99 von 2012, statt Hardcover für 27,- von 2005.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/364232403 ... +rauchfuss
Über http://b-ok.org/s/?q=Horst+Rauchfuss&ye ... nsion=&t=0
findet sich dazu auch etwas, auf Englisch. Überhaupt viele Dinge zu finden dort (Nachfolger von bookzz, thanks to @Struktron for the hint elsewhere)
So far,
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Ich versuche einmal einen Ansatz, abstrakt festzuhalten, was die Translation ausmacht, indem nur von (Makro)molekülen zu sprechen sein soll, ohne Differenzierung:
Im Endeffekt ein Makromolekül, das die Information enthält, wie es sich mit Hilfe von anderen Makromolekülen kopieren kann (reproduzieren) und gleichzeitig die Information enthält, wie diese anderen Makromoleküle zu generieren sind, wofür ebensolche schon passend vorhanden sein sollten, beim ersten Mal.
Ein bzw. das Henne-Ei-Problem in Reinstform, zu Beginn halt.
Und ich befürchte, dass der Ansatz zu vereinfacht ist noch und vielleicht einfach falsch auch...
Gruß,
Dgoe
Im Endeffekt ein Makromolekül, das die Information enthält, wie es sich mit Hilfe von anderen Makromolekülen kopieren kann (reproduzieren) und gleichzeitig die Information enthält, wie diese anderen Makromoleküle zu generieren sind, wofür ebensolche schon passend vorhanden sein sollten, beim ersten Mal.
Ein bzw. das Henne-Ei-Problem in Reinstform, zu Beginn halt.
Und ich befürchte, dass der Ansatz zu vereinfacht ist noch und vielleicht einfach falsch auch...
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Vergiss Tor, Unsinn. Hier. (Tor ist sehr rechtschaffend) Der ansonsten Tor- Link ist Quatsch dort. Die großen Buttons auch.
Nur wie das geht, das dort vieles steht, in Debatte zum Urheberrecht, kann ich nicht erklären. Ist halt so.
Ich persönlich habe aufgrund dessen hier einen Einblick gewonnen und rund 23,- Euro definitiv bezahlt, einkaufenderweise.
So what.
Nur wie das geht, das dort vieles steht, in Debatte zum Urheberrecht, kann ich nicht erklären. Ist halt so.
Ich persönlich habe aufgrund dessen hier einen Einblick gewonnen und rund 23,- Euro definitiv bezahlt, einkaufenderweise.
So what.
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Okay, ATGC, angenommen, man dürfte alle diese von Dir oben genannten Makromoleküle nicht mehr beim Namen nennen, sondern nur MAKROMOLEKÜLE nennen. Wie sieht dann das Bild aus.
Wenn Dir mein Ansatz nicht passt, dann kannst Du den vielleicht verbessern, ohne differenzierter zu werden.
Also ohne das:
Wenn Dir mein Ansatz nicht passt, dann kannst Du den vielleicht verbessern, ohne differenzierter zu werden.
Also ohne das:
Wie kann man das ohne das Geblubber darstellen?Translation ist zunächst mal nur der Prozess, mit Hilfe von Basensequenzen (mRNA und tRNA's) eine Aminosäuresequenz zu erzeugen. Dass die erzeugten Aminosäuresequenzen in Gestalt von Polypeptiden als Enzyme wirken, die sowohl für den Stoffwechsel wie auch für die Regulation der Translation geeignet sind, hat mit der Translation zunächst nichts zu tun. Diese abgeleiteten Funktionen ergeben sich über den biochemischen Kontext des Zellstoffwechsels, in den die Translation als Schlüsselprozess eingebettet is
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Bitte nicht anmaßend oder beleidigend zu verstehen. Ich möchte das sozusagen jemand erklären, der außer Makromoleküle keinen Plan hat. Wie?
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Dummerweise habe ich mittlerweile mehr Einblicke, aber wäre ansonsten genau jener selbst.
Ist vielleicht zuviel verlangt, aber wie wäre es, wenn man nur von Makromolekülen sprechen dürfte?
Ist vielleicht zuviel verlangt, aber wie wäre es, wenn man nur von Makromolekülen sprechen dürfte?
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo ATGC,
da musste ich jetzt länger darüber nachdenken. Vielen Dank für den Input allemal, erst einmal. Als erstes war mir unklar, ob Du am Ende das erste oder das zweite Makromolekül meintest. Ich gehe mal vom Ersten aus, klang erstmal sinniger.
Aber das wäre dann ja da und damit als Vorlage vorhanden!? Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht etwas länger beschreibbar, ohne die Moleküle namentlich oder Genremäßig zu benennen noch?
Die Lektüre, das Buch ist übrigens heute angekommen, sind ja nur 409 Seiten...


Na, freu' mich, alles gut, super!
Gruß,
Dgoe
da musste ich jetzt länger darüber nachdenken. Vielen Dank für den Input allemal, erst einmal. Als erstes war mir unklar, ob Du am Ende das erste oder das zweite Makromolekül meintest. Ich gehe mal vom Ersten aus, klang erstmal sinniger.
Aber das wäre dann ja da und damit als Vorlage vorhanden!? Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht etwas länger beschreibbar, ohne die Moleküle namentlich oder Genremäßig zu benennen noch?
Die Lektüre, das Buch ist übrigens heute angekommen, sind ja nur 409 Seiten...
Na, freu' mich, alles gut, super!
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hust. Wieso? Ich schätze Erik Verlinde sehr, zuletzt viel vom ihm gehört auch, aus Kanada etc. Ich kann nur nichts beurteilen inhaltlich (wer kann das schon), alles sehr interessant, höchste Referenzen genießend.
Hallo Lothar,
Dies Dein Zitat, das Zitat von Dir widerspricht allerdings allem, woran ich glaube und überzeugt von bin. Es gibt nichts, was zuuu kompliziert ist und es gibt nichts, was ergo nicht online zu diskutieren möglich wäre.
Mach mal halblang.
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
-
ralfkannenberg
- Ehrenmitglied
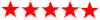
- Beiträge: 3587
- Registriert: 13. Jan 2017, 10:00
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo Lothar,Struktron hat geschrieben: ↑22. Nov 2017, 00:21In Quanten.de wurde gerade das Thema geschlossen, wo dies der entscheidende Faktor ist. Stochastische Prozesse oder gar Pfadintegrale, wo die Rückkopplung für ganz "einfache" Systeme in der Physik angewendet wird, sind aber immer noch zu kompliziert, um in Onlineforen diskutiert werden zu können.
kannst Du mir bitte kurz helfen, welcher Thread im Quanten.de das war ?
Freundliche Grüsse, Ralf
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Das Henne-Ei-Problem lässt sich lösen:
Das Ei war natürlich zuerst da!
Genauer: Der Kreisprozess, der als ein Zwischenergebnis Ei-artiges produziert ist sehr alt, viel älter als Hühner, universell und hat sich mehrmals unabhängig entwickelt.
Man findet ihn bei Fischen, bei Wirbellosen, bei Pflanzen (Samen), in gewisser Weise sogar bei Einzellern (Sprossung, Endosporen).
D.h.: Der besagte Prozess kam in der Vielzahl wo er überall wirkt irgendwann auch an den Punkt, wo das erste Hühnerei von einem Nicht-Huhn gelegt wurde, wobei "Huhn" und "Nicht-Huhn" nur Begriffe sind, die sich erst durch unser kategorisch-ordnendes Denken ergeben, die Natur kümmert das nicht, sie tut einfach was sie tut, sie kennt ebenso Sprünge wie auch langsame Übergänge, sie hat weder ein Problem mit "Halb-Hühnern" noch mit "Nicht-Huhn legt Hünerei".
D.h. auch, dass das Henne-Ei-Problem ein Problem ist, das sich erst durch eine spezielle, nicht für alles geeignete Herangehensweise an das Betrachtete manifestiert, bzw. durch ein ebensolches Denken bzw. Fragen erst generiert wird.
Insofern hast du natürlich Recht. Die Retrospektive ist hier ein Problem, das uns klar einschränkt. Wir finden es ebenso in der Evolution und der Kosmologie.
D.h. aber nicht, das wir gar nichts sagen oder abschätzen können, es heißt, dass das was wir rein aus der Retrospektive sagen können, hier immer unsicherer sein wird, da sich die Argumentationen indirekterer Argumente bedienen müssen, selbst dann, wenn wir nur Wahrscheinlichkeitsaussagen generieren.
Ich finde du bist an der Stelle in deinem Denken zu sehr einem Kategoriendenken verhaftet.ATGC hat geschrieben: ↑25. Nov 2017, 15:32Dieser Standardsatz der Dialektik ist hier aber nicht anwendbar, da es eben nicht einfach nur eine sukzessive Vermehrung von Molekülen und Prozessverläufen betrifft, sondern eine andere Art von Wechselwirkungen, die nicht einfach mal so als spontanes "Umkippen" infolge von genügend "Masse" entsteht. Die Dinge sind hier diffiziler - und sie sind prinzipiell unvorhersagbar.Quantität schlägt irgendwann in Qualität um.
Eine sukzessive Vermehrung von Molekülen und Prozessverläufen, so sie denn in einem System existiert (hier ist schon zu beachten, dass man die Größe eines halboffenen Systems prinzipiell frei wählen kann: eine flüssigkeitsgefüllte Pore, ein Bereich, ein Landstrich, die Erde, das Sonnensystem, usw.), erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein Umkippen.
Insofern erhöht auch hier Quantität die Wahrscheinlichkeit für das Umschlagen in Qualität.
Du kennst dich da mit den Details viel besser aus, was würdest du meinen?
Wie gesagt würde ich eine Top-Down-Perspektive zusätzlich zu einer Bottom-Up-Perpektive vorschlagen.
Bei der Bottom-Up-Perpektive analysierst du das Leben, so wie man es heute vorfindet, zerlegst es in seine materiellen Teile plus die Wechselbeziehungen dieser Teile und fragst dann, wo diese Teile und Wechselbeziehungen herkommen können.
Bei der Top-Down-Perpektive schaust du dir die Systeme insgesamt an und fragst zunächst ungeachtet der Teile, welche grundsätzlichen Prozesse da ablaufen. Da geht es dann nicht mehr um Moleküle, Materie oder materielle Elemente, die sind da prinzipiell austauschbar, sie sind sekundär. Es geht auch nicht mehr um Chemie oder Biologie oder Mechanik, es geht um abstraktere Dinge.
Ein zentraler Prozess ist z.B. die Reproduktion. Das hast du in lebenden Zellen, du hast es aber auch bei zellulären Automaten (https://de.wikipedia.org/wiki/Zellul%C3%A4rer_Automat) und du hast es auch schon, wenn du ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff hast und die erste Reaktion 2H2 + O2 -> 2 H2O + Energie abläuft, vielleicht angetrigert durch ein kosmisches Teilchen das von einer Supernova hierher kam:
Die Energie die aus dem Prozess der ersten Bildung eines H2O-Moleküls frei wurde, sorgt dafür, dass weitere H2O-Moleküle gebildet werden, deren freiwerdende Energie sorgt dafür, dass noch mehr H2O-Moleküle entstehen, das Ganze nennt man eine Explosion.
Man kann es in einem anderen System auch kontrolliert ablaufen lassen, wenn man Wasserstoff und Sauerstoff in einem Fließgleichgewicht durch eine Brennerdüse leitet und das Ganze zündet: Es entsteht eine Wasserstoffflamme und wir haben einen Reproduktionsprozess: Das Entstehen von H2O sorgt dafür, dass immer noch mehr H2O gebildet wird. Das Ganze läuft so lange stabil weiter, wie die Systemrandbedingungen hinreichend stabil sind (so lange Wasserstoff und Sauerstoff ins System nachgeliefert werden und so lange H2O und ein Teil der Energie aus dem System entweichen kann).
Oder nimm die Planetenbildung: Am Anfang hast du nur Staubkörner, diese treffen sich zufällig und agglomerieren aufgrund elektrostatischer Kräfte. Wenn solche Agglomerate dann eine gewisse Größe erreicht haben, dann schlägt der Prozess um, weil dann ganz langsam zunehmend auch die Gravitation für das Wachstum eine Rolle spielt, bis sie zuletzt völlig dominat ist.
Dort würdest du wahrscheinlich auch von einer kategorisch völlig neuen Qualität sprechen, was ja auch so gesehen nicht falsch ist, der Prozess ist aber abstrakter gesehen derselbe geblieben und heißt nach wie vor "Strukturbildung" oder "Massevermehrung", er bedient sich nur unterschiedlicher Mechanismen und repliziert bzw. erhält sich -als Prozess- selber, er ist selbstverstärkend.
Solche Prozesse sind wahrscheinlich nicht so sehr evolutionsfähig, wie wir das im Auge haben, aber man kann daraus lernen, dass der grundsätzliche Prozess bzw. das Prinzip "Reproduktion" sehr viel einfacher sein kann als bei Ribosomen. Man kann auch leicht einsehen (siehe Henne-Ei), dass er älter und universeller als das Leben ist.
Weiterhin kann man feststellen, dass ein Reproduktionprozess, der evolvierfähig sein soll, nicht perfekt sein darf: Der Fehler ist für jede Evolution absolut notwendig.
Gleichzeitig darf er aber auch nicht völlig aus Fehlern bestehen, denn sonst können sich keine Strukturen halten.
Bei lebenden Systemen ist die Fehlerrate sehr gering, das ist aus meiner Sicht der Hauptunterschied zu komplexen physikalisch-chemischen Systemen wo die Fehlerrate bei Prozess-Reproduktionen sehr viel größer ist, vielleicht fast 100%. Wichtig ist mir aber, dass das abstrakt gesehen nur ein gradueller Unterschied ist.
Und die große Fehlerrate bei chemischen Systemen sorgt eben gleichzeitig auch für eine viel größere Bandbreite in dem was geschieht bzw. geschehen kann.
Komplexere zusätzliche Struktur entsteht aus so etwas immer durch Einschränkung/Reduktion oder Separierung dieser Bandbreite.
Das finden wir sogar in der Entwicklung des menschlichen Gehirns: Bei Babys bildet das Gehirn zunächst eine Unmenge an Verbindungen zwischen den Neuronen, sozusagen ein Chaos aus Verbindungen, die aber eine sehr hohe Bandbreite an Möglichkeiten bereitstellen. Erst danach wird reduziert: Die Verbindungen die häufig benutzt/gebraucht werden, werden verstärkt/verstärken sich selber, die anderen Verbindungen werden abgebaut. So entsteht das sehr viel sturkturiertere Gehirn eines Erwachsenen, nicht durch ein Mehr, sondern durch ein Weniger, durch Reduktion.
Dasselbe Prinzip kann man sogar in der Quantenmechanik erkennen, wenn man möchte: Aus der verschwommenen Quantenwelt der Vielzahl an Möglicheit und "sowohl als auch" entsteht entweder durch Reduktion (KI) oder durch Separaration (VWI) unsere vertraute, strukturiertere, konkrete Welt.
D.h.: Frage nicht nur nach Molekülen, frage auch abstrakter!
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Noch zwei Anregungen:
https://www.chemie.uni-kl.de/fachrichtu ... e&lev4=dynSystems Chemistry
Definition
Systems Chemistry (Systemchemie) ist ein neues Forschungsgebiet, in dem das Verhaltens von komplexen Netzwerken miteinander wechselwirkender Moleküle untersucht wird.
Der Begriff Systems Chemistry wurde in Analogie zu dem Begriff Systems Biology gewählt, dem Forschungsgebiet, das sich mit dem Verständnis des Wechselspiels aller Komponenten in einer Zelle beschäftigt. Andere Beispiele komplexer Systeme sind der Finanzmarkt, das World Wide Web, die Ökologie usw. Komplexe Netzwerke in der Chemie sind beispielsweise die Komponenten innerhalb einer Dynamischen Kombinatorischen Bibliothek, deren Verhältnis empfindlich von äußeren Einflüssen abhängt.
...
Diese Ergebnisse haben eine große Bedeutung:
• Sie zeigen, dass die Kombination zweier reversibler Prozesse zu einem Verhalten innerhalb eines Netzwerks interagierender Moleküle führen kann, das nicht durch Thermodynamik, sondern durch Kinetik bestimmt wird.
• Sie zeigen, dass selbstreplizierende Moleküle spontan aus einem Pool geeigneter Startmaterialien entstehen können.
• Sie zeigen das Potential der Dynamischen Kombinatorischen Chemie auch für die Entwicklung neuer selbstassoziierender Materialien.
https://www.chemie.uni-kl.de/fachrichtu ... e&lev4=macSynthetisches Ribosom
Das Ribosom in Zellen dient zur Proteinsynthese. In der Gruppe von Leigh wurde ein Rotaxan entwickelt, das die sequentielle Synthese eines kurzen Peptids gestattet, wodurch seine Funktion eine gewisse Ähnlichkeit mit der des Ribosoms besitzt. Das Rotaxan wurde mithilfe der active metal template Strategie dargestellt.
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
-
positronium
- Ehrenmitglied
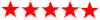
- Beiträge: 2832
- Registriert: 2. Feb 2011, 20:13
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo Dgoe und Ralf und alle anderen,
ich schrieb:
Bei meinen einfachen Simulationen hatte ich immer die notwendige Entstehung von Elementarteilchen aus den gleichen kleinsten Objekten, aus welchen nach meinem Postulat das Vakuum besteht, im Hinterkopf. Langsam kristallisierte sich heraus, dass meine abrupten Geschwindigkeitsänderungen nicht vereinbar mit (unendlich oft) notwendiger Differenzierbarkeit sind. Das geht über die mathematischen Methoden der Standardphysik hinaus und es gibt wenige Erfahrungen dazu. Deshalb fand ich in den Foren oder im Usenet bisher niemanden, der da helfen könnte.
Aktuell und auch das hiesige Thema betreffend sind die Überlegungen von Verlinde. Speziell das holographische Prinzip könnte schon auf der Ebene der Elementarteilchenbildung von Bedeutung sein. Durch deren Oberflächen sollte ein Einfluss auf die Umgebung stattfinden. Das ist dann eine gewisse Information, welche sich durch das Vorkommen anderer gleichartiger Elementarteilchen dem gesamten Raum aufprägen sollte. Das führt mMn zu einer Rückopplung bzw. Rückwirkung durch die Oberflächen der Elementartarteilchen und kann zu deren Stabilität beitragen.
Ähnliche Mechanismen sollten dann auch für zusammengesetzte Strukturen (Atome, Moleküle,...) gelten. Einige Argumente dazu wurden schon von Talbot (Das holographische Universum) aufgeführt.
MfG
Lothar W.
ich schrieb:
Das Thema hieß: Ist die Standardphysik einfacher als gedacht? Bei der Erstellung dieses Themas dachte ich noch, Berechnungen mit Hilfe der Mathematik, welche man bis zum Abitur lernt, sollten einfacher sein, als beispielsweise die, welche für die aktuellen Versuche zur Erweiterung der Standardphysik (also z.B Schleifen-Quantengravitation, Strings, ,...) erforderlich ist.In Quanten.de wurde gerade das Thema geschlossen, wo dies der entscheidende Faktor ist. Stochastische Prozesse oder gar Pfadintegrale, wo die Rückkopplung für ganz "einfache" Systeme in der Physik angewendet wird, sind aber immer noch zu kompliziert, um in Onlineforen diskutiert werden zu können.
Bei meinen einfachen Simulationen hatte ich immer die notwendige Entstehung von Elementarteilchen aus den gleichen kleinsten Objekten, aus welchen nach meinem Postulat das Vakuum besteht, im Hinterkopf. Langsam kristallisierte sich heraus, dass meine abrupten Geschwindigkeitsänderungen nicht vereinbar mit (unendlich oft) notwendiger Differenzierbarkeit sind. Das geht über die mathematischen Methoden der Standardphysik hinaus und es gibt wenige Erfahrungen dazu. Deshalb fand ich in den Foren oder im Usenet bisher niemanden, der da helfen könnte.
Aktuell und auch das hiesige Thema betreffend sind die Überlegungen von Verlinde. Speziell das holographische Prinzip könnte schon auf der Ebene der Elementarteilchenbildung von Bedeutung sein. Durch deren Oberflächen sollte ein Einfluss auf die Umgebung stattfinden. Das ist dann eine gewisse Information, welche sich durch das Vorkommen anderer gleichartiger Elementarteilchen dem gesamten Raum aufprägen sollte. Das führt mMn zu einer Rückopplung bzw. Rückwirkung durch die Oberflächen der Elementartarteilchen und kann zu deren Stabilität beitragen.
Ähnliche Mechanismen sollten dann auch für zusammengesetzte Strukturen (Atome, Moleküle,...) gelten. Einige Argumente dazu wurden schon von Talbot (Das holographische Universum) aufgeführt.
MfG
Lothar W.
https://struktron.de/
Szenario der Entwicklung des Universums
Szenario der Entwicklung des Universums
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Warte mal ATGC, das möchte ich genauer analysieren und abstrahieren, nämlich mit alfabetischen Buchstaben. Aber vorerst bin ich uneins mit seeker:
Hey Seeker,
Meine Notizen Zu Deinem Text:
bei allem Respekt und ich habe alles gelesen von Dir (was vielleicht nicht jeder macht), etwas (hoffentlich konstruktive) Kritik, aber frei Schnauze erst mal:
So einfach ist das nicht mit 1-2 Fehlern irgendwo so etwas wie die Translation in Gang zu setzen. Die zelluläre Automaten bringen das bei weitem auch nicht, leider. Wäre ja zu schön (zu einfach).
Auch nicht durch irgendwelche Explosionen und
Ja und dann sprichst Du plötzlich von "lebenden" Systemen, Hallo noch jemand da? Dass das Eine zum Anderen kommt ist noch Thema, das Thema! Wie es dazu kommt nämlich?
Auch Reduktion und Separaration erklärt genau nichts erstmal.
Der Rest mit Gehirnen und Babys und so weiter, setzt ja schon alles voraus wo wir noch gar nicht sind. Also hier über das Leben zu labern, zu reden, nachdem es schon da ist, ist ja einfach.
Etwas angenervt von Deiner ellenlangen Nichtssagerei,
Und zwischendrin die Planetensimale, hallo. Den Vergleich lasse ich nicht gelten, voll Banane. Entschuldigung.
Und sorry für den Ton, ich kann nicht wirklich anders, schätze Dich ansonsten sehr, sag aber meine Meinung.
Gruß,
Dgoe
Hey Seeker,
Meine Notizen Zu Deinem Text:
bei allem Respekt und ich habe alles gelesen von Dir (was vielleicht nicht jeder macht), etwas (hoffentlich konstruktive) Kritik, aber frei Schnauze erst mal:
So einfach ist das nicht mit 1-2 Fehlern irgendwo so etwas wie die Translation in Gang zu setzen. Die zelluläre Automaten bringen das bei weitem auch nicht, leider. Wäre ja zu schön (zu einfach).
Auch nicht durch irgendwelche Explosionen und
Ja und dann sprichst Du plötzlich von "lebenden" Systemen, Hallo noch jemand da? Dass das Eine zum Anderen kommt ist noch Thema, das Thema! Wie es dazu kommt nämlich?
Auch Reduktion und Separaration erklärt genau nichts erstmal.
Der Rest mit Gehirnen und Babys und so weiter, setzt ja schon alles voraus wo wir noch gar nicht sind. Also hier über das Leben zu labern, zu reden, nachdem es schon da ist, ist ja einfach.
Etwas angenervt von Deiner ellenlangen Nichtssagerei,
Und zwischendrin die Planetensimale, hallo. Den Vergleich lasse ich nicht gelten, voll Banane. Entschuldigung.
Und sorry für den Ton, ich kann nicht wirklich anders, schätze Dich ansonsten sehr, sag aber meine Meinung.
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hmm... an dem Punk sind wir uns ja eh einig, weil wir ja beide sagen, dass die Wahrscheinlicheikt für das Auftauchen von Leben auch auf einem habitablen Planeten mindestens derzeit noch unbekannt ist.ATGC hat geschrieben: ↑28. Nov 2017, 15:07Wenn es um numerische Wahrscheinlichkeiten geht, können wir hier tatsächlich nichts abschätzen, weil wir a) die konkreten Rahmenbedingungen nicht kennen und b) aus den zugrundeliegenden Wechselwirkungen nicht auf das Erscheinen und die Art und Weise der übergeordneten Wechselwirkungen schließen können.D.h. aber nicht, das wir gar nichts sagen oder abschätzen können.
Da scheint es mehr um Worte zu gehen...
Dennoch ist das mit den Wahrscheinlichkeiten so eine Sache, eine Wahrschenilichkeit ist kein kausaler Zusammenhang, sondern ein Maß für unser Wissen/Unwissen.
Mit Wahrschenilichkeiten operiert man, wenn man zu wenig weiß, um klare Kausalzusammenhänge angeben zu können, aber genug weiß, um für ein idealisiertes Modell des betrachteten Systems quantifizieren zu können, wie viel man nicht weiß.
An der dabei notwendigen Idealisierung/Modellierung hängt dabei vieles, es bedeutet nämlich, dass sich eine Wahrscheinlichkeitsaussage nie direkt auf das betrachtete reale System bezieht, sondern immer auf das Modell vom System. D.h.: Wahrscheinlichkeitsaussagen sind immer mit einer Unsicherheit behaftet, die davon abhängt wie gut sich Modell und reales System tatsächlich gleichen.
Beispiel:
(1) Ein Würfel wird geworfen. Nach dem Wurf liegt die "6" oben. Warum?
Wenn ich alle notwendigen physikalischen Details kennen würde, könnte ich das exakt nachvollziehen, dass nur die 6 oben liegen kann, indem ich das aus Kausalzusammenhängen ableite.
Aber mein Wissen reicht dafür nicht aus, also generiere ich eine Warscheinlichkeitsaussage.
Ich idealiere dazu den realen Würfel und tue so, wie wenn er ein perfekter idealer Würfel wäre. Alsdann schaue ich mir die Symmetrieeigenschaften an und komme zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit für eine "6" nach dem Wurf exakt 1/6 ist.
Der reale Würfel ist aber nicht perfekt, er hat winzige Dellen, Symmetrieabweichungen, der Würfelprozess ist auch nicht ganz ideal-exakt, usw. deshalb ist die Wahrscheinlichkeit für eine 6 nicht exakt 1/6, was ich aber nicht weiß, da ich diese Details auch nicht kenne und es sehr schwer ist sie herauszufinden und noch schwerer zu wissen, ob man genügend herausgefunden hat.
Das ist sozusagen die Situation aus der Retrospektive.
Es gibt noch einen anderen Fall:
(2) Ich weiß so viel und so wenig über den Würfel wie zuvor, kann aber zusehen, wie er 1 Million mal geworfen wird, schreibe die Einzelergebnisse auf und mache Statistik.
Es kommt dabei vielleicht heraus, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis "6" 1:6,1 war. Und ich kann das hier wissen, ohne den Würfel mitsamt Umgebung unters Elektronenmikroskop gelegt zu haben, das ist einfacher, deshalb mögen wir es so. (Wobei auch 1:6,1 ungenau sein wird, hätte man 1 Milliarde mal gewürfelt, so wäre 1:6,1077 herausgekommen. Und ob tatsächlich 1 Million mal wirklich gleich gewürfelt wurde ist auch nicht einfach herauszufinden und modellabhängig, auch an dem Punkt muss man idealisieren.)
Bei der Frage nach der Lebensentstehung hätten wir das deshalb auch gerne so, aber dafür müssten wir wohl erst noch 1 Million habitable Planeten finden und bereisen/ vor Ort untersuchen.
Blöd...
Und selbst wenn wir das getan hätten: Dann hätten wir nur eine Statistik, die zwar allgemeine Aussagen über eine Menge von Planeten erlaubt, aber dennoch keine Aussage über unseren speziellen Planeten, eben weil Wahrscheinlichkeitsaussagen keine Aussagen über Kausalzusammenhänge sind. Wenn ich Auto fahre und die Wahrschenlichkeit einen Unfall zu haben statistisch gesehen x% pro Jahr beträgt, was sagt das dann kausal darüber aus, ob ICH nächstes Jahr einen Unfall haben werde? Gar nichts.
Wir brauchen (1) und (2) um wirklich weiterzukommen.
Richtig. Wir brauchen (1) und (2) um wirklich weiterzukommen, wir brauchen auch Kenntnisse über konkrete Kausalzusammenhänge.ATGC hat geschrieben: ↑28. Nov 2017, 15:07Der Haken bei dieser Argumentation ist dann aber, dass über die reale Wahrscheinlichkeit, die sich numerisch beziffern lässt, nichts bekannt ist. Man kann daher das Umschlagen in eine neue Qualität nicht als Fakt postulieren, wenn man eine gegebene Quantität einfach nur vergrößert.Insofern erhöht auch hier Quantität die Wahrscheinlichkeit für das Umschlagen in Qualität.
Allerdings können uns solche Überlegungen den Weg weisen.
Ja. Deshalb ist das immer noch spannend, was dort noch zu entdecken sein mag.ATGC hat geschrieben: ↑28. Nov 2017, 15:07Die Top-Down-Ansätze setzen alle bereits ein funktionierendes System der Proteinbiosynthese voraus, denn sie operieren mit Minimal-Genomen. Und Genome definieren sich über die Enzyme, die mit ihrer Hilfe repräsentiert sind, weil diese Enzyme dann den Minimal-Stoffwechsel am Laufen halten, der die Minimal-Zelle am Leben erhält. Zwischen beiden Ansätzen klafft also die Lücke, die durch den Translationsmechanismus überbrückt wird. Hier haben wir die "Schallmauer", die bereits Jacques Monod Ende der 1960er Jahre so benannte. Seitdem sind wir hier nicht wirklich weiter gekommen, trotz einer Reihe von theoretischen Ansätzen, die sich jedoch einer experimentellen Prüfung bislang entzogen haben.
Du kannst aber danach suchen, was Leben ganz abstrakt bedeutet, welche abstrakten Zutaten/Prozesse es geben muss. Dann kannst du danach suchen, inwieweit so etwas auf den verschiedenen Ebenen gegeben sein kann, inwieweit nicht und inwieweit teilweise/in Ansätzen. Manche Dinge findest du überall, manche nicht - un das ist spannend.ATGC hat geschrieben: ↑28. Nov 2017, 15:07Aber nur in der mathematischen Modellierung. In echt geht es immer um Physik, Chemie und Mechanik, weil hier Moleküle involviert sind und keine mathematischen Terme. Darum entzieht sich die Lösung des Problems um die Entstehung des Lebens trotz verfügbarer Molekularbiologie und Biochemie beharrlich seit reichlich 50 Jahren. Hier kommst Du mit Mathematik und diversen Abstraktionen nicht weiter. Auch die Beispiele bezüglich Knallgasreaktion und Planetenbildung bilden das Problem, das mit der Abiogenese verknüpft ist, nicht adäquat ab.Da geht es dann nicht mehr um Moleküle, Materie oder materielle Elemente, die sind da prinzipiell austauschbar, sie sind sekundär. Es geht auch nicht mehr um Chemie oder Biologie oder Mechanik, es geht um abstraktere Dinge.
Was ist "Leben", wenn du es ganz abstrakt definieren musst?
Nicht "nur", aber "auch". D.h. Kerzenflammen haben auch ein Gemeinsames mit echtem Leben, ebenso ein Nicht-Gemeinsames, beides ist von Interesse.ATGC hat geschrieben: ↑28. Nov 2017, 15:07Man kann auf diese Weise auch über Kerzenflammen meditieren (die reproduzieren sich sogar über Stoffwechsel), aber verfehlt damit den Punkt, dass es sich bei der Translation nicht einfach nur um einen Stoffwechselprozess handelt, über den Proteine reproduziert werden.
Die Frage ist, ob so etwas nicht auch in anderen komplexen Systemen zumindest in Ansätzen vorhanden sein kann. Konkreter: Ist das ein einziger großer Sprung oder sind es viele kleinste Treppenstufen oder ist es gar etwas vornehmlich Kontinuierliches? Ich bin fast zu einem "sowohl als auch" und "manchmal so und manchmal so" geneigt, das kennen wir schon von der Biologischen Evolution.
Wie sieht der Übergang von komplexer Chemie zu sehr komplexer Chemie zu Biologie aus?
Ist sehr komplexe Chemie tatsächlich nur Chemie?
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo Dgoe, ich versuche einfach über Themen nachzudenken, die mich interessieren und dabei zu inspirieren und inspiriert zu werden und so dazuzulernen, das ist alles.
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Weil's grad reinpasst, hier noch ein neuerer interessanter Bericht, incl. Quellenangaben:
Hintergrund:
https://www.mpg.de/11494864/hintergrund
https://www.mpg.de/11494138/leben-meteo ... che?c=2191Wie das Leben auf die Erde kam
Forscher liefern Szenario, nach dem die Bausteine für die ersten RNA-Moleküle mit Meteoriten auf unseren Planeten gelangt sind
2. Oktober 2017
Astronomie Chemie (M&T) Evolutionsbiologie Sonnensystem
Wissenschaftler der McMaster University und des Max-Planck-Instituts für Astronomie haben ein stimmiges Szenario für die Entstehung von Leben auf der Erde berechnet, das auf astronomischen, geologischen, chemischen und biologischen Modellen basiert. Demnach formte sich das Leben nur wenige hundert Millionen Jahre, nachdem die Erdoberfläche soweit abgekühlt war, dass flüssiges Wasser existieren konnte. Die wesentlichen Bausteine für das Leben wurden während der Entstehung des Sonnensystems im Weltraum gebildet und durch Meteoriten in warmen kleinen Teichen auf der Erde deponiert.
Hintergrund:
https://www.mpg.de/11494864/hintergrund
Grüße
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
seeker
Wissenschaft ... ist die Methode, kühne Hypothesen aufstellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben.
Karl Popper
Re: Entstehung des Lebens auf der Erde
Hallo seeker, ja klar, ich ja auch. Ich war sicher auch zu sehr verstrickt da drin, wo ich dann schnell Kritik drin sehe zu anderen Gedankengängen. Alles gut. Muss gleich auch erst mal neueres seitdem lesen, leider nicht dauern on hier.
Gruß,
Dgoe
Der Optimist glaubt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Pessimist befürchtet, dass der Optimist damit Recht hat.

